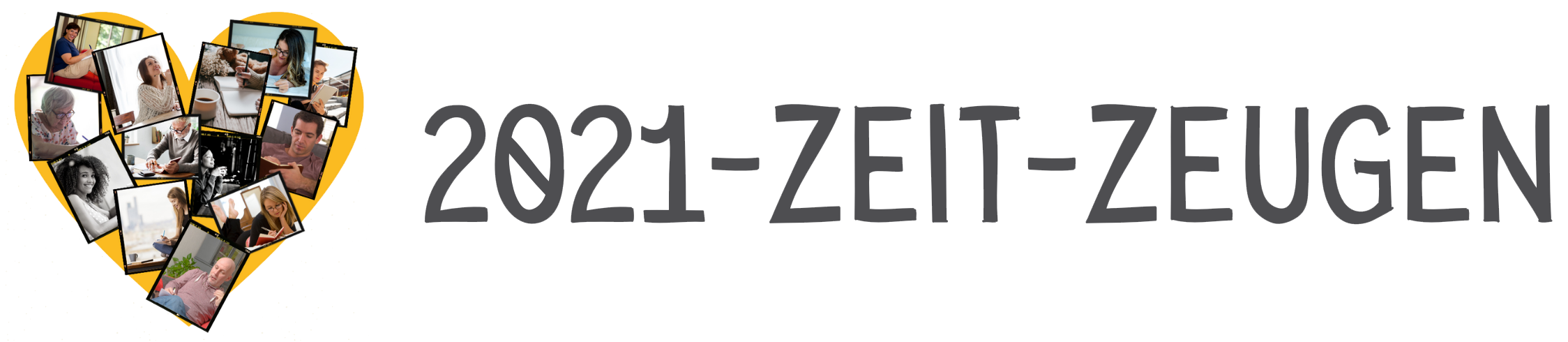Ich liebe sie und ich hasse sie: Nicht schön, ziemlich dick und schwer. Teuer war sie auch. Jahrzehntelang fotografierte ich gerne. Das Gefühl, einen Filmstreifen zwischen Daumen und Zeigefinger entlang zu ziehen. Ein feines Zittern und ein ängstliches Pfeifen des Films: Ob er wohl zufrieden ist, mit dem was er da sieht? Meistens freute ich mich. Festgehaltene Augenblicke des Glücks.
Manchmal drückte ich einfach so den Auslöser, ohne Film. Dieses Geräusch! Klick und Klack. Seitdem ich mit drei Jahren auf den Knien meines Vaters sitzend, so einen Knopf drücken durfte, kam ich davon nicht mehr los. Bis der Spaß vorbei war: keine Filme mehr. Nichts zum Anfassen. Ab heute alles digital. Unbegreiflich. Lange wehrte ich mich gegen den sogenannten Fortschritt, bis die Vernunft siegte.
Wie befürchtet, so geschah es: Das neue Ding führte sich als widerspenstige Diva auf. Dreimal zurück zur Garantiereparatur. Der Verschluss – eine Fehlkonstruktion. Aller paar Monate neue Nullen und Einsen einspielen – bis die Kamera nach drei Jahren machte, was ich wollte. An guten Tagen.
Meistens ließ ich sie im dunklen Fotorucksack. Soll sie dort liegen, bis sie schwarz wird! „Das bin ich schon.“ – flüsterte sie gehässig. Ich muss nicht fotografieren! Es gibt noch andere schöne Spielzeuge… Und überhaupt: Was ist ein Foto meiner Frau gegen eine Umarmung meiner Frau?
Im Urlaub besserte sich die Beziehung. Die digitale Knipsmaschine hatte etwas gutzumachen und gab sich Mühe. Fotos im Dunkeln? Kein Problem. Dreihundert Bilder Wald, Seen und Himmel? „Ich hätte noch Platz für die nächsten dreitausend!“ Mein Zittern bei der Motivsuche – sie glich es stillschweigend aus.
„Bleib so, das sieht sooo schön aus.“ Meine Frau ließ sich nicht gerne fotografieren. An diesem Nachmittag auf den Klippen war es anders. Ihr Haar wehte im Wind. Sie blickte mich an und ignorierte die Kamera. Das Foto von unserem letzten Urlaubstag in Schweden hängt an der Wand und ich rede durch das Foto mit ihr. Manchmal scheint mir, ihr Gesichtsausdruck würde wechseln. Gestern freute sie sich, als ich ihr einen Strauß Freesien zum Geburtstag vor das Bild stellte. Ihre Lieblingsblumen.
Nachts träumte ich, vor einer Kiste mit alten Filmen zu sitzen: Eine blaue Schachtel fällt mir in die Hände. Ein Film, den ich nicht kenne. Auf allen Fotos meine Frau. Von mir fotografiert. Diese Fotos habe ich nie gemacht! In diesem Moment wachte ich auf. Schade.
Nun muss ich mich allein um mich kümmern. Ab und zu hilft mir die Kamera: „Du könntest mal wieder mit mir ausgehen.“ Na gut. Sie ist zwar kein Hund, aber ich habe trotzdem Mitleid mit ihr. Nicht, dass der Verschluss verharzt. Kameracorona würde den Tod bedeuten. Ich will keine neue Diva.
Heute? Seit Tagen drückt es über die Höhen dichten Nebel zwischen die Häuser. Grau und kalt mit höchstens hundert Meter Sichtweite. Ein Wetter, das zur Stimmung passt: Kein Licht am Horizont. Der Blick reicht bis zur nächsten Ecke. Frohe Zukunft gibt’s anderswo. Ich muss nicht fotografieren. Zur Kamera greife ich als Alibi, um das Haus zu verlassen.
Wie so oft, auf dem selben Weg: Übers Feld zum Wasser, zurück durch Wiese und Wald. Motive erwarte ich nicht. Immerhin: Ich hebe den Kopf, suche meine Mitte und gehe ganz langsam. Tief einatmen und noch langsamer ausatmen. Immer wieder. So achtsam, wie ich es gelernt habe.
Der Nebel schluckt den Hintergrund und ich sehe Bilder: Unten, auf dem Weg zum See, fiel vor Monaten ein Baum im Sturm – quer über den Weg. Jedes Mal, wenn ich darunter durchlaufe, fällt mir ein, wie schnell es mit mir vorbei sein könnte. Ich vertraue dem Baum. Er wird sich schon abstützen – groß und stark, wie er einmal war. Doch heute erschrecke ich: Der riesige, schwere Stamm wird nur von einem dünnen Bäumchen gestützt! Unter der Gewalt brach es selbst und hält im Sterben den alten Baum.
Kamera raus. Objektiv wechseln. Mein Puls geht nach oben. Ich muss nicht denken, finde die Tasten blind. Klick – Klack – Klick – Klack. Kniebeuge. Dankeschön. Meditatives Fotografieren. Zu Hause fällt mir der Bildtitel ein: Die letzte Stütze. „Die letzte Stütze der Demokratie ist die Justiz. Wenn auch die fällt, haben wir Diktatur.“ – warnt ein mutiger Anwalt.
Weitergehen. Es wird schon dunkel und ich beginne zu frieren. Ich fotografiere ohne Pause: Einsame Büsche auf dem Feld, die den Mindestabstand einhalten. Die Häusergruppe am Wald sieht heute wie eine Burg aus. Diese Welt muss draußen bleiben. Fünf einsame Pfähle, die irgendeine Grenze sinnlos bewachen. Tugendwächter.
Ein paar Büsche, Gräser und wilde Obstbäume drängen sich auf schmalem Rand, umgeben vom monotonen Meer der genetisch gleichen Schwachhalme. Die Restfläche – das Leben der Anderen.
Ich denke an meine wirre Frisur. Seit Monaten kein Friseur. Vor mir steht ein einsamer Apfelbaum mit wilder Krone und erduldet den Eiswind. Er weiß, es wird irgendwann wieder Frühling werden. Hier stehe ich und kann nicht anders. Wer weiß, wann ich wieder blühen darf?
Dort unten – die Kleingärten mit ihren Lauben, aufgereiht wie Lagerbaracken hinter dem Drahtzaun. Das Quarantänelager? Daneben der große Grabhügel, der hier schon seit 1762 an den Tod erinnert. Ein guter Ort – das Jenseits. Mein Weg führt in weitem Bogen bergauf. Sein Ende verschwindet im Nebel. Einfach weitergehen, egal was kommt.
Es ist Zeit, in meine Burg hinaufzusteigen, einen Kaffee zu kochen. Und die Kamera? Die darf noch ein paar Stunden im Rucksack schlafen. Kondenswasser würde die digitalen Geister zerstören. Meine Fotos schaue ich mir morgen an. Alte Schule: Wer gelernt hat, auf Film zu fotografieren, trägt die Bilder im Kopf.
Ein wenig habe ich die dicke schwarze Diva lieben gelernt. Wegen der gemeinsamen Erinnerungen an meine Frau, an Schweden und die guten Zeiten. Ich brauche sie mehr denn je. Besser, ich mache mir meine eigenen Bilder.