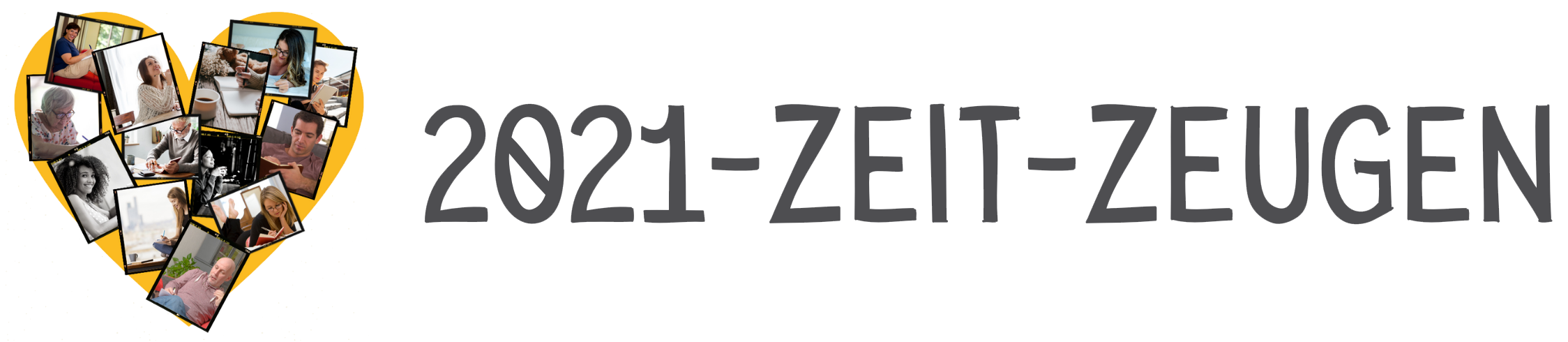„Ziemlich klein geschrieben.“ Mein Blick wendet sich zu meinem Mann. „Mit Brille nicht!“ Und unmittelbar erkenne ich, dass dieser Gegenstand für mich eine große Bedeutung hat. Wer hätte das gedacht? Das Buch, das ich lese, könnte ich ohne sie nicht lesen. Es bliebe ein Geheimnis für mich.
War die Lesebrille gestern ein selbstverständliches Ding auf der Nase, so ist sie heute eine Kostbarkeit. Nicht nur der Preis macht sie kostbar, sondern der Mehrwert, den sie mir schenkt. Was wäre ich ohne sie? Ich blicke sie berührt an.
Ohne Brille bin ich darauf angewiesen, dass andere mir Texte vorlesen. Wenn sie denn man mal Zeit haben. Hilfe! Die Buchstaben wären für mich zu klein geschrieben. Einzig auf Plakaten läse ich die Textzeilen zügig. Ich weiß, ich werde alt. Seufz. Ach nein, mir ist die Brille doch schon in die Wiege gelegt worden. Ich spinne.
Ich liebe das kostbare Luxusteil unserer Zeit. In jeder Farbe kommt es modern daher. Die braunen Hornbrillen, die es Ende der 60-iger gab, hasste ich. Ihre dicken Gläser waren schwer. Die Brillenbügel scheuerten auf den Ohren. Aua! Und zu allem war immer eine Seite mit Pflaster zugeklebt. Ich sah nur die Hälfte. „Die ist doof.“ Ich weinte. Mama umarmte mich. „Warte noch ein Weilchen, dann ist das Pflaster ab.“ „Warten, immer warten.“, maulte ich. „Und wie sehe ich aus!“ Ich schaute nicht mehr in den Spiegel. „Ich will die nicht!“ Aber es nützte nichts. Besseres gab es nicht. Ich war ihr spinnefeind. „Vergiss die Brille nicht.“, sagte Mama und passte auf, dass sie mit mir zur Schule ging.
Heute spüre ich die Brille auf der Nase kaum. Sie lässt mich klug aussehen.
Ohne sie bin ich nicht in der Lage, meinen Beruf auszuüben. Sie ist mein Handwerkszeug. Meine Brille bedeutet mir viel. Ohne sie wären der Laptop und der PC nutzlos für mich. Ich liebe meine Brille.
Um bei der Wahrheit zu bleiben, inzwischen besitze ich drei Brillen. Eine blaue, eine türkise und eine grünblaue. Ihr merkt schon, ich stehe auf Blau. Ich liebe alle drei Brillen. Sie sind meine Augen.
Die Lesebrille reichte eines Tages nicht mehr für das Arbeiten am PC. Da kaufte ich mir eine Bildschirmarbeitsbrille. Sie ruht sich nachts im schwarzen Brillenetui aus. Morgens ist sie der erste Gegenstand, den ich bei Arbeitsbeginn in die Hand nehme. Schwupps sitzt sie auf der Nase. Dort verbringt sie ihre Tage mit mir. Ich bin ihre beste Freundin.
Ich ziehe sie hin und wieder auf die Nasenspitze, damit ich über sie hinwegschauen kann. Sie und ich sind uns nicht immer einig. Ich möchte keine verschwommenen Menschen sehen. Und sie bleibt stur bei ihrer Meinung, 60 Zentimeter Abstand. Der Rest ist unlesbar. Ich streite mich mit ihr. Und ihr ist es egal. Da nehme ich sie dann ab. Das hat sie nun davon!
Sie gibt mir einen Spielraum. In ihm überbrücke ich den Abstand zwischen meinen Augen und dem Bildschirm. Dann lese ich, was da steht. Zahlen zum Beispiel. Ich verwechsele die Ziffern, die sich ähneln, nicht mehr. Da klappt es mit dem Zusammenrechnen gleich besser. Ja, sie kann auch rechnen. Und ich mit ihr.
Mein Arbeitgeber zierte sich zuerst, sie zu bezahlen. „Sie kostet ein kleines Vermögen!“, sagte er. „Stimmt.“ Ich drehte mich um und meine Nase stieß fast an den Bildschirm.
Doch der Betriebsarzt half mir. Er überzeugte ihn von der notwendigen Anschaffung. „Dann geben Sie ihr am besten einen Besen in die Hand, statt eines PCs.“ Aber der Chef hatte schon einen Hausmeister. Und der hat am PC zwei linke Hände. Da habe ich echt Glück gehabt.
Stellt Euch vor, es ist mir sogar verboten, diese Brille mit nach Hause zu nehmen. Was für eine unsinnige Anordnung! Ich würde das nie tun. Es ist überhaupt nicht möglich, mit der PC Brille Bücher zu lesen. Ich habe es ausprobiert. Mit dem Laptop kommt sie auch nicht klar. Das enttäuschte uns. Nun liegt sie in meiner Freizeit in der Schreibtischschublade herum und langweilt sich. Die Arme.
Dafür trage ich die Lesebrille in der Handtasche beständig mit mir. Und dort hole ich sie heraus, lege sie auf den Tisch. Dann beschließe ich, im Malzimmer zu arbeiten, und schleppe sie mit dorthin. Wo parkt sie am besten? Ah, hier auf dem Stuhl ist sie sicher vor der Farbe.
Ich streiche mit dem Pinsel Farbe aufs Papier. Später brauche ich Collagepapiere und trage sie herbei. Diese Papiere sortiere ich nach Farben. Alles, was nicht ins Bild passt, lege ich neben mir ab. Was steht auf der grünen Papierseite? Leider nicht lesbar. Ach, meine Brille. Wo ist sie wieder hin? Kennt ihr das auch? Dauernd versteckt sie sich. Das geht mir auf die Nerven.
Ich suche zuerst auf dem Tisch im Wohnzimmer. Nicht da. „Liegt sie in der Handtasche?“ Ich schlendere ins Nebenzimmer. Nein. Ich kneife die Augen zusammen und denke nach. Beim Laptop vielleicht? Auch nicht. Wo ist mein Handy? Ich suche es. Ich finde das Handy in der Küche und das Brillenetui daneben. Ich bin erleichtert. Was wollte ich nochmal mit der Brille? Mir fällt es wieder ein. Ich nehme das Etui und gehe ins Malzimmer. Dort öffne ich es. Es ist leer. „Oh, manno!“ Ich hasse diese Ersatzteile im Alter, die sich vermehren. Den Text auf dem Collagepapier kann ich immer noch nicht lesen. Ich sammele die Papierschnipsel zusammen. „Da bist Du.“ Die Brille lag zuunterst. Ich setze sie auf die Nase und lese:
„Ein Buch ist wie ein Garten, den man in der Tasche trägt. (Arabisches Sprichwort)“ Ich lache. „Aber nur, wenn die Brille daneben zu finden ist.“
Meine dritte Brille ist übrigens eine Fernbrille. Sie liegt immer im Auto. Das Auto fährt manchmal ohne mich weg. Dann kann ich mit dem Rad nicht losfahren.
Und was hat dieser Text nun mit Corona und einem Gegenstand, der in der Coronazeit eine andere Bedeutung für mich hat, zu tun? Nichts, aber ich hatte Spaß, ihn zu schreiben. Das Schreiben ist die Freude, die mich durch die Coronazeit trägt. Die Brille macht es möglich. Nicht immer bin ich mir mit ihr einig. Manchmal ärgert sie mich. Hin und wieder vertreibe ich mir die Zeit mit dem Suchen nach ihr. Und sie ruft nicht mal „Piep“, wenn ich sie rufe. Und das alles war auch schon vor Corona so.