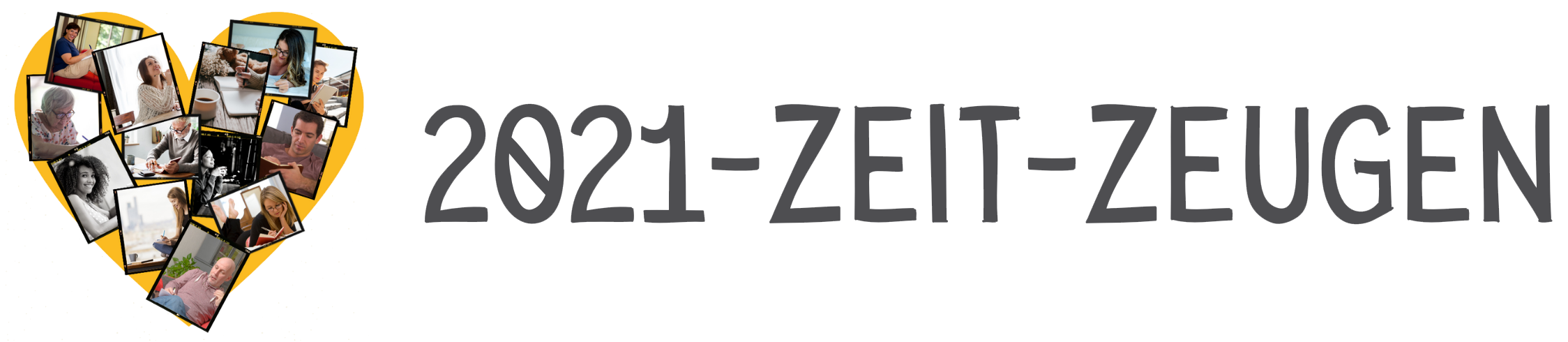natürlich!- mein nach dem Bruch langsam heilendes Handgelenk.
Seit mehr als acht Wochen lebe ich ohne selbstverständlich zuverlässige, unterstützende, tragende, schreibende, strickende, haltende, streichelnde, dienende rechte Hand. Sie fehlt mir. Mein Leben ist ein gänzlich anderes.
Ich habe mich, ehrlich gesagt, schon häufiger gefragt, was es bedeutet, dass dieser, mein persönlicher Lockdown, der mich auf Spaziergänge rund ums Haus reduziert, der mein geliebtes Radfahren unmöglich macht, der selbst das Kochen oder Backen verbietet, mit dem allgemeinen Lockdown zusammenfällt.
Beim Winterspaziergang mit einer Freundin, als uns heftiges Schneetreiben überraschte, war ich so sehr auf jeden Schritt konzentriert, um nur ja nicht auszurutschen und auf meine Hand zu stürzen, dass ich die kostbare Stunde nicht genießen konnte.
Selbst Bücher zu halten war kein Genuss mit nur einer Hand; das Umblättern jedes Mal eine Anstrengung. In gewohnten Lesefluss kam ich nicht.
Manchmal habe ich gedacht, dass es hilfreich ist, dass die Welt um mich herum heruntergefahren ist. Außer arbeiten zu gehen, unternahmen meine Lieben auch kaum mehr als ich. Ich war halt noch ein bisschen ruhiger, noch ein bisschen mehr auf einen Ort reduziert, noch ein bisschen mehr von jedem Kontakt abgeschnitten.
Irgendetwas will das mir sagen, hab ich oft gedacht.
Aber was?
Ich habe jeden Tag meditiert. Habe mir kluge Vorträge angehört und mir Tätigkeiten und Spiele mit meinem Hund ausgedacht, die im Haus machbar waren. Und war irgendwie unzufrieden. Es half eher nicht, wenn jemand fragte: Was machst du eigentlich den ganzen Tag?
Manchmal saß ich am Fenster und schaute in den Garten, beobachtete das Treiben der Vögel an den Futterstellen und war in Ruhe und Stille. Auf eine Weise war das schön, auf andere spürte ich ein Kribbeln und wäre am liebsten losgesprungen in die Welt. Fröhlich, freudig, lebendig, neugierig Losspringen in die Welt, das fehlt mir so sehr.
Mein Jammern darüber, dass das nicht geht, beschränkt sich nicht nur auf die einschränkenden Coronamaßnahmen, ich habe die Einschränkung auch an und in mir; zuerst als blaue Gipshand und inzwischen als graue Orthese. Im Moment bin ich reduziert auf —: Leben in Wärme und Wohlstand mit Tulpenlieferung nach Onlinebestellung, mit Kontakt über Internet oder Telefon zu den meisten meiner lieben Menschen, mit echt gelebtem Kontakt zu dem Kameraden meines Lebens und manchmal, sehr umsichtig mit Maske und Abstand, zu einem unserer Kinder, mit Zugang zu Wald und Wiese, mit geschenktem Winterwonderland für eine ganze Woche… Ich traue mich gar nicht, noch mehr von all dem aufzuzählen, auf das ich „reduziert“ bin.
Bin ich maßlos, wenn ich mich dennoch unwohl und betrübt, eingeschränkt und ausgebremst, festgehalten und unbeweglich fühle? Mir gehen die Coronafolgen und meine persönlichen Folgen durch den Bruch des Handgelenks durcheinander. Eines ohne das andere kann ich nicht beleuchten. In meinem Leben ist es zusammen da, hat jedes Ereignis für sich Auswirkung, die irgendwie perfekt zur Auswirkung des anderen passt. Sie arbeiten sozusagen Hand in Hand. Und meine Hand arbeitet nicht.
Mit meinem Verstand kann ich klar sehen, dass ich trotz allem im Überfluss lebe. Etwas in mir tut sich schwerer damit und wagt lediglich vereinzelt, Glücksgefühle zuzulassen. Am besten gelingt mir das im Skype Kontakt mit meinen Enkelkindern. Dann kann plötzlich Lachen und Freude aus tiefstem Herzen aufsteigen, von dort, wo sonst zurzeit ein dickes Schloss ein Aufbrechen verhindert. Warum nur glaube ich, die Freude dort verschließen zu müssen? Was hindert mich, ungebremst froh zu sein?
Als ich vor Jahren in einer Radiosendung hörte, dass jeden Winter 80% unserer Singvögel sterben und ich sie gleichzeitig im Garten jubilieren und trillern hörte, dachte ich: Wenn uns Menschen das bevorstünde, würde niemand mehr singen. Wir würden in Angst erstarren, wie hypnotisiert die Zahl „20% Überlebende“ fixieren und inständig hoffen, dass wir dazu gehören.
In Angst und Abwehr zu erstarren, das ist, glaube ich, das was mir gerade droht. Und der Bruch meines Handgelenkes ist meine Chance, etwas anderes zu spüren und wahrzunehmen. Schmerz und Einschränkung zwingen mich, mich zum Beispiel um Ideen zum Ankleiden zu kümmern. Hab ich eine Hose mit Gummizug? Welcher T-Shirtärmel passt über den Gips? Wo finde ich eine Plastiktüte, die beim Duschen schützt? Schaffe ich kürzere Tagebucheinträge womöglich mit der linken Hand?
Die Einschränkung setzt Bereicherung und Kreativität in Gang. Ach, guck…