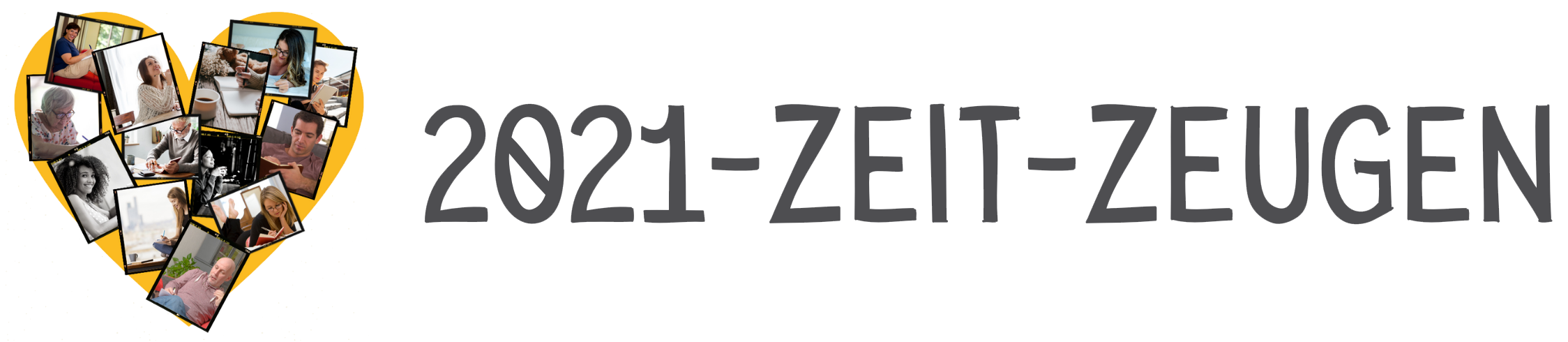Ich gehöre zu einer privilegierten Gruppe, ich bin bereits in Pension, habe ein gesichertes Einkommen, lebe in einem großen Haus am Land, bin umgeben von Natur – und mach seit vier Semestern an der Uni Wien das Studium Generale, seit zwei Semestern allerdings nur noch online im distance learning.
Das hat mich zu Beginn irritiert, nach nur einer Woche war im März letzten Jahres die Präsenz an der Uni vorbei; die online-Veranstaltungen hatten Startschwierigkeiten, aber nach ein paar Wochen hat sich alles eingespielt – die online-Vorlesungen wurden zu einem willkommenen Anlass der Verbindung nach draußen. Ich habe alle Aufgaben mit Freude und Engagement erfüllt und bin ins Masterprogramm eingestiegen und werde eine Masterarbeit zum Thema „Wert der Arbeit“ schreiben, allerdings muss ich die konkreten Fragestellungen mit meinem Betreuer erst festlegen.
Das Thema ist durchaus von Corona inspiriert: während des 1. Lockdowns im Frühjahr 2020 wurden alle Systemerhalter*innen, wie Pfleger*innen, Handelsangestellte, alle Beschäftigten im Gesundheitsbereich … als wahre Held*innen gefeiert, mit Lob bedacht und beklatscht – doch dann wurden sie mit einer einmaligen Prämie abgespeist und sind mittlerweile wieder im Alltag angekommen und ihre Leistungen sind wieder selbstverständlich geworden; über den „WERT“ ihrer Arbeit macht sich niemand mehr Gedanken.
Ich habe daher begonnen, darüber nachzudenken, wie lässt sich der „Wert“ der Arbeit bestimmen und mir ist ein Gleichnis aus der Bibel eingefallen: Die Arbeiter im Weinberg, die unterschiedlich lange arbeiten, aber am Ende des Tages den gleichen Lohn erhalten, einen Dinar, der das Leben einer Familie für einen Tag sichert – Ist das Gerechtigkeit? Sicher nicht, aber woran kann man den Wert der Arbeit ablesen?
Ich habe viele Jahre mit Langzeitarbeitslosen gearbeitet, vor allem Frauen. Die Gründe für ihre Arbeitslosigkeit waren vielfältig, auch ihre Arbeits- und Leistungsfähigkeit – am Monatsende erhielten alle den gleichen Lohn. Alle versuchten, ihre Arbeit zu machen, aber die Anstrengung dahinter war sehr unterschiedlich.
Corona bringe gerade für die Arbeitswelt viele neue Herausforderungen und raubt so manchem seine Exostenzgrundlage. Daher, ich bin in einer privilegierten Situation, aber ich mache mir Gedanken, wie ein neues Wirtschaftssystem aussehen könnte.
Mich stört diese Sehnsucht nach der „alten Normalität“ – ich glaube nicht, dass es ein Zurück gibt, es braucht eine neue Normalität, es braucht Visionen für eine gerechtere Welt – aber das ist noch nicht angekommen bei den dafür Verantwortlichen. Die Politik kämpft einen Kampf gegen das Virus, das ihnen immer einen Schritt voraus ist; ja, die Maßnahmen sind vernünftig, um die Verbreitung des Virus einzudämmen, aber es wird keinen Sieg geben, es werden neue Viren, neue Bedrohungen auftauchen und wir müssen lernen, damit zu leben.
Ich gehöre einer privilegierten Gruppe an, ich habe den größten Teil meines Lebens in Frieden und Wohlstand verbracht, ich konnte reisen, wohin ich wollte, ich habe die Erde einmal umrundet, ich verfüge über einen Schatz an Erinnerungen, Erfahrungen und ich habe schwierige Situationen gemeistert.
Meine Sorge gilt meinem Sohn, er wird eine andere Welt erleben und ich kann ihm meine privilegierte Situation nicht vererben. Ich hoffe, ich habe ihm das Rüstzeug mitgegeben, sich in einer Welt, die derzeit von Unsicherheit, Verlust von Solidarität und einer immer stärker wachsenden Kluft zwischen arm und reich geprägt ist, in der demokratische Strukturen gefährdet sind, in der Gier nach Geld und Macht herrscht und Humanität und Teilen als Schwäche ausgelegt werden – dass er sich in dieser Welt behaupten und seinen Platz finden kann.