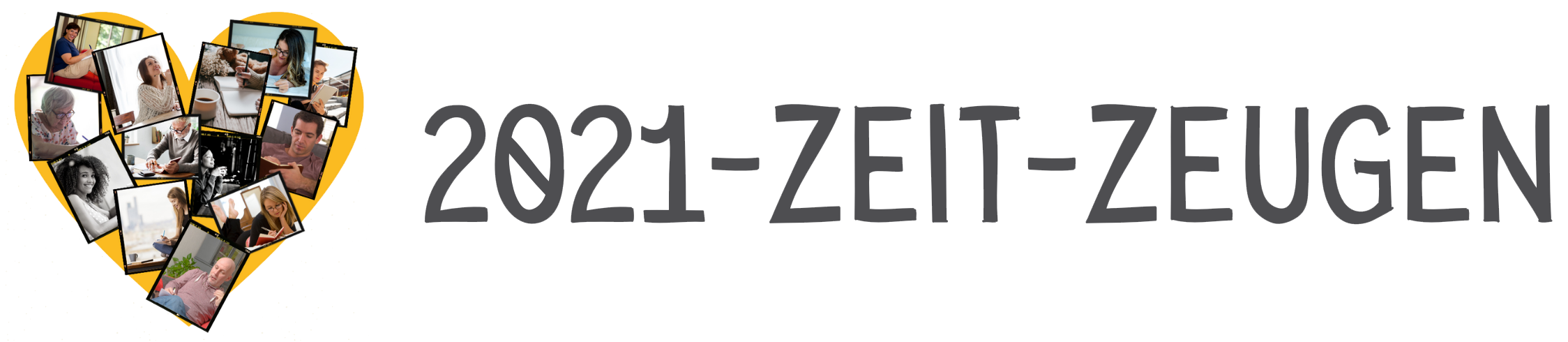Es ist ein strahlend schöner Sonntagmittag im Februar. Die Sonne scheint von einem kondensstreifenfreien blauen Himmel. Sein Blau leuchtet, dass ich meine Augen schließen muss. Mit geschlossenen Augen stehe ich da. Ich stehe und spüre. Den Wind, der sanft durch mein Haar fährt. Sanft, aber noch kühl. Ein Rest des Winters, ein Rest der Kälte der vergangenen Wochen haftet ihm noch an. Ich spüre die Sonne, wie sie mein Gesicht wärmt. Hinter meinen geschlossenen Lidern tanzen die Farben des Regenbogens einen Freudentanz. Sonne. Licht. Wärme. Ich atme tief ein und halte die Luft an. Langsam lasse ich die Luft entweichen, nachdem ich mich stattgetrunken habe an ihrer Fülle. Die aufgebrochene, feuchte Erde auf dem Acker. Ich rieche den kommenden Frühling.
Noch immer stehe ich mit geschlossenen Augen da, schwanke leicht vor und zurück. Vögel zwitschern. Sie jubilieren, als wäre dieser Tag das ganze Leben. Ich bin, zwitschern sie. Hier. Ich bin hier. Ich lebe.
Ich setze mich auf eine Bank. Hoch oben über dem Tal habe ich eine wunderbare Aussicht. Ich blicke mich um und kann es kaum glauben, dass ich das in all den Jahren, die ich schon hier lebe, noch nicht entdeckt habe. Ich versinke im Schauen und staune. Es ist, als sähe ich die Welt heute zum ersten Mal. Das Kloster in der Ferne auf einem Berg. Den sich sanft dahinschlängelnden Fluss, eher ein Flüsschen, so schmal wie er hier ist. Die noch nackten Stämme der Bäume auf den Hängen.
Eine leise Bewegung neben mir lässt mich zusammenzucken. Ich schaue links neben mich und spüre, wie sich ein Lächeln warm in mir ausbreitet. Meine Hoffnung. Klein ist sie geworden, schießt es mir durch den Kopf, ja, klein und zerknautscht sieht sie aus. Sie hat ihren Blick zu mir gehoben. Zärtlich blicke ich sie an, ein bisschen fragend. Als sie vorsichtig nickt, nehme ich sie in meine Hände und setze sie auf meinen Schoß. Ich spüre, wie sie schuddernd zusammenfährt. Sanft lege ich ihr mein Halstuch um, das ich nach dem anstrengenden Anstieg abgelegt hatte. Sie seufzt unhörbar und kuschelt sich auf meinem Schoß ein bisschen zurecht. Mit meinem Zeigefinger streichele ich sie sehr vorsichtig und sehr sacht.
Meine Hoffnung. In den letzten Wochen und Monaten war sie mir abhandengekommen. Zuerst hatte ich es kaum bemerkt. Ich hatte ja zu tun, ich war bemüht, beschäftigt zu wirken, es musste doch weitergehen, immer weiter. Ich durfte nicht stehenbleiben, nicht anhalten. Und so war ich durch meine Tage gestolpert, immer in dem Bemühen, mir selbst zu beweisen, dass doch alles noch so war wie immer, dass ich nur tapfer weitermachen müsste.
War meine Hoffnung damals schon nicht mehr mit mir gegangen? Ich weiß nicht, wann ich sie verlor. War es, als im Herbst der Lockdown-light verkündet wurde und mit seiner Verkündung die Hilflosigkeit spürbar wurde in dem Versuch, etwas aufzuhalten, was doch längst nicht mehr aufzuhalten war? Oder war es, als uns gesagt wurde, wir müssten uns nur noch etwas mehr anstrengen, dann würden wir alle fröhlich Weihnachten feiern dürfen? Ich glaube, spätestens da hat sich meine Hoffnung zurückgezogen.
Es folgten dunkle und schwere Wochen. Von Tag zu Tag wurde mir enger ums Herz. Es fiel mir immer schwerer, zu atmen. Am liebsten hätte ich mich zu einem tiefen und langen Winterschlaf zusammengerollt und dann würde ich wieder aufwachen, wenn alles vorbei wäre. Das müsste doch möglich sein, oder?! Ich schlief viel. War ich wach, lief alles so verlangsamt ab, jede noch so kleine Besorgung kostete Kraft. Manchmal mehr als ich zu haben glaubte. Manchmal flossen Tränen, einfach so, wenn ich die Nachrichten nicht ausblenden konnte und sich die Bilder in meinem Kopf selbständig machten und mich in meine Träume verfolgten.
Ich bewegte mich auf einen Abgrund zu. Meinen Abgrund. Er ist mir vertraut, schon mein Leben lang. Immer wieder einmal hatte ich an seinem Rand gesessen und hinuntergeblickt, doch immer wieder hatte meine Hoffnung mich gefunden, immer wieder war ich aufgestanden und an ihrer Hand zurückgegangen.
Wo war sie jetzt? Wo war meine Hoffnung jetzt, da ich ihrer so bitter bedurfte? Du musst etwas machen, was dir guttut, rieten die Leute. Malen. Schreiben. Musikmachen. Spazierengehen. Nutze die Zeit. Und ich malte. Schrieb Worte auf leeres Papier. Machte Musik. Ging hinaus. Wo war meine Hoffnung?
In diesen Tagen hielt uns mein Engel, so glaube ich heute. Mein Engel, der uns jeden Tag ein Gedicht schickt, per SMS, mein Engel, der uns mit einem fröhlichen Rotkehlchen auf einer Postkarte beglückte, mein Engel, der uns ein Paket Tee vor die Tür stellte. Mein Engel, der meine Hoffnung und mich nicht verloren gab. Und als die Tage langsam spürbar heller wurden, begann ich vorsichtig, Lebensfäden aus seinen Gedichten zu binden, begann, ein Netz zu knüpfen, von dem ich hoffte, dass es tragen würde.
Meine Hoffnung bewegt sich auf meinem Schoß. Ich schaue sie an. Erkenne in ihren dunklen Augen, dass sie noch nah an meinem Abgrund sitzt. Ich zupfe das Tuch ein wenig zurecht. Hab keine Angst, möchte ich ihr sagen. Doch mein Mund bleibt stumm. Ich halte meine Hände zu einer Höhle verschränkt, dass sie sich bergen kann in mir. Oder ich mich in ihr?
Die Sonne scheint noch immer. Es ist, als wachte ich aus einem langen, tiefen Schlaf auf. Meine Ohren hören. Vogelgezwitscher, Hundebellen, Stimmen. Es sind Wanderer. Sie grüßen, als sie näherkommen.
Bleib bei mir, flüstere ich meiner Hoffnung zu, verlass mich nicht. Lass uns zusammen noch ein Stückchen weitergehen.