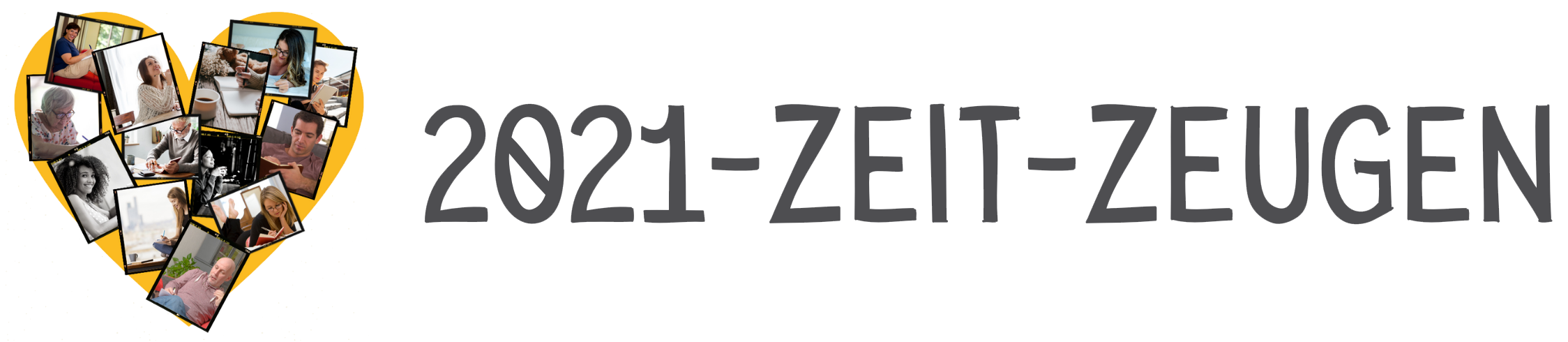In ein Restaurant. Dort ankommen. „Guten Abend“, der Kellner begrüßt mich an der Tür. „Darf ich Sie zum Tisch geleiten.“ Er schlendert vorweg. Ich hinterher. „Ist es Ihnen hier angenehm?“ Er weist auf einen Zweiertisch am Fenster. Ich freue mich. „Ja.“ Meine Freundin wird in spätestens fünf Minuten dazu kommen. Die Bedienung entfernt sich. Ich lege die Jacke ab und hänge sie an die Garderobe, die hinter mir an der Wand befestigt ist. Dann hocke ich mich auf den Stuhl.
In Wirklichkeit steht der Stuhl in meiner Küche. Da gibt es keinen Kellner. Ich warte auf den Tag, an dem das Virus nicht mehr gefährlich ist. Das Auftauchen des Virus ist ein Alptraum, den ich nie träumen wollte.
Wie lange werde ich warten? Ein Jahr? Oder zwei? Oder den Rest des Lebens? Geduld ist nicht meine Stärke.
Ich drehe den Kopf und blicke in den Speiseraum. Eine Wand trägt ein Bild, das wildverlaufene Spuren in Gelb und Schwarz zeigt. Es belebt den Raum ebenso, wie das Stimmengesumme der Menschen an den Tischen. Dort wird gelacht, hier klirren Gläser. Die Eingangstür öffnet sich und meine Freundin tritt ein. Ich winke. Sie sieht mich und kommt zu mir. „Hallo, lange her, dass wir uns sahen.“ Ich nicke. Ein ganzes Jahr ist vergangen, seit wir uns im Steakhaus trafen. Ich warte immer noch auf das nächste Treffen. Sie auch.
„Ob das Bild noch an der Wand hängt?“, schießt es mir durch den Kopf. Mit der rechten Hand schäle ich eine Kartoffel. Keiner in der Familie mag es, Kartoffeln zu schälen. Ich gehe ein paar Schritte in der Küche herum. Das Telefon am Ohr spreche ich: „Die Kinder waren lange nicht da, fürchten, uns mit dem Virus anzustecken.“
Ich würde so gerne einmal wieder zum Essen ins Restaurant gehen. Es ist so lange her. Wir haben Corona. Meine Schwester sagt zu dem Virus immer „Corinna.“ Das klingt mir viel zu nett. Sie ist ein es und doof, denke ich.
„Ich brauche zum Essen nichts zu trinken.“ Mein Mann füllt sich den Teller voll. Ich habe gekocht, die Töpfe auf den Tisch gestellt. Ich bin Koch und Kellner in einem.
„Zu Hause schmeckt es doch am besten.“, sagt er. Ich sehe das anders.
Ich räume den Tisch auf und stelle die Erdbeeren hin. Vormittags war ich mit dem Rad in der Stadt auf dem Markt. Die Beeren lachten mich an, obwohl ich eine Maske trug, keine Skimaske. Neuerdings müssen wir auf dem Holstenplatz, wenn Markttag ist, eine FFP2 Maske tragen. Ich hasse das.
Mich überrollen die Gefühle. So verletzlich komme ich mir mit einer Maske vor. Alleine. So weit weg von den Menschen, die mit mir in der Schlange vor dem Erdbeerstand stehen und warten. Mir fehlt die Freiheit. Vor einem Jahr war ich ein freier Mensch, der sein Gesicht zeigte. Heute bin ich unsichtbar. Das verletzt mich, die es liebt, frei zu sein.
Ich kaufe die Erdbeeren. Zu Hause in der Küche säubere ich sie. Es ist März und die Beeren flogen um die halbe Welt zu uns. Ich richte sie mit einer Puderzuckerhaube an. Das sieht aus wie Schnee auf dem Kilimandscharo. Dort war ich noch nie.
Wir piken die Erdbeeren einzeln mit den Gabeln auf. Ich stecke eine in den Mund, beiße zu. Kaue. Saft tropft mein Kinn herunter.
Wir essen alle Beeren auf. In der Nachtischschüssel bleibt eine Saftpfütze zurück. Sie hat eine cremerosa Farbe. Die erinnert mich an etwas. „Ein Sonnenaufgang am Meer.“ Ein Urlaub an der Nordsee. Er sagt: „Da waren wir vor Corona.“ Stimmt.
Für dieses Jahr gibt es keinen Urlaubsplan. Wir wissen nicht wohin. Das Virus ist schon da. Es belegt die Betten. In die wollen wir uns nicht legen und das Ding mit nach Hause tragen. Wie werden wir es dann wieder los? Impfen? Aber wir sind noch nicht dran. Es bleibt uns nur, zu warten. Das macht mich so müde.
„Bist Du satt?“ Er erhebt sich. „Ja.“ Er räumt den Tisch ab, stellt das Geschirr in den Spüler. „Ich mache dann jetzt meine Mittagsstunde.“, sagts und verschwindet in die Stube aufs Sofa. Ich blicke ihm nach, erhebe mich im Schneckentempo vom Stuhl und verlasse die Küche, um in mein Zimmer zu schleichen. Dort verhalte ich mich leise, bin mit mir und meinen Gedanken alleine.
Ich würde so gerne mal wieder mit Dir zum Essen gehen. So gerne Pläne schmieden. So gerne reisen. So gerne Gäste einladen. So gerne reden und lachen, das Leben genießen.
Wie lange muss ich denn noch warten?