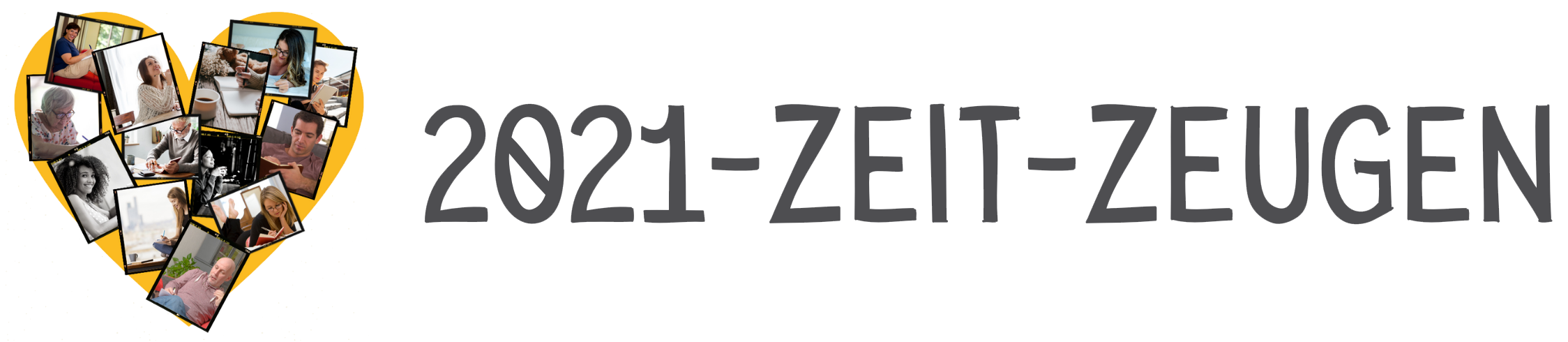Corona ist wie eine Lupe, ein Brennglas, das Löcher brennt, wenn ein Lichtstrahl das dicke, geschliffene Glas lange genug trifft.
Corona hat mich komplett aus meinem gewohnten Leben gedrängt. Aus Angst vor einer Infektion frage ich mich unsicher: Kann ich noch im Museum arbeiten? Tag der offenen Begehung: wenn es gut läuft, kommen mehrere Hundert Menschen. Viele sprechen mich als eine Mitarbeiterin an, kommen mir nah, weil sonst kann man nicht mit gedämpfter Stimme miteinander reden, um die anderen Besucher nicht zu belästigen. Habe Angst vor den vielen Menschen und Angst, mit meiner Angst unter den KollegInnen aufzufallen. Einigen ist aber auch nicht wohl.
Drei Wochen später soll die Eröffnung einer großen Wechselausstellung stattfinden mit Werken bekannter KünstlerInnen: Bruce Nauman, Maurizio Nanucci, Tracey Emin… Schweren Herzens sage ich meinen Einsatz einen Tag vorher ab. Das Datum vergesse ich nicht, 12. März 2020. Einen Tag später, am 13. März, beginnt der erste Shutdown. Seitdem habe ich nicht mehr im Museum gearbeitet. Zu gefährlich – zuhause pflege ich meinen kranken Mann.
Wunderbar: mein Arbeitsvertrag ruht, meine Arbeit habe ich nicht verloren. Und doch…kann ich nicht arbeiten. Habe jede Freiheit und alle Zeit der Welt endlich aufzuräumen, alte Papiere wegzuwerfen, zu putzen, einen Artikel zu schreiben, Fotos zu sortieren, ein Projekt ins Leben zu rufen oder genauer einzuhegen. Stattdessen Grenzenlosigkeit: der Tag liegt wie eine riesige Ebene vor mir. Alle Strukturen muss ich selbst schaffen. Wie oft verschiebe ich etwas in die Abendstunden und wundere mich, dass ich nicht einschlafen kann. Luxusprobleme, klar, die Wohnung ist groß genug, die Kinder aus dem Haus und Ideen blitzen auf und doch …
Mir fehlt der Kontakt mit den Menschen, der sinnliche Blick-Wort-Gesten Kontakt, mit der Tochter, dem Sohn (sie halten sich wegen ihres kranken Vaters sehr zurück), mit den Freundinnen und Freunden, ja gerade auch mit den ArbeitskollegInnen und den Menschen in meinen Führungen durch die Ausstellungen. Ein Stirnrunzeln oder Lächeln beim Nachdenken als Reaktion auf das, was sie von mir hörten. Paare, die sich plötzlich an den Händen hielten, eine Frau weinte.
Ich habe geübt. Ich habe geübt und tue es noch, Menschen mit Maske in die Augen zu blicken, wenn ich ihnen begegne, im Supermarkt, in der Apotheke, bei ÄrztInnen. Dem Mann meiner Buchhändlerin, der mir meine Wünsche nach Hause bringt. Und ich habe geübt, fremde Blicke zuzulassen. Das Bedürfnis auf beiden Seiten, mit Fremden einige freundliche Worte zu wechseln und gleichzeitig zu wissen, dass Reden das Virus beflügelt.
Die Telefonate mit lieben Menschen werden häufiger. Halte die Telefone zunehmend nicht mehr ans Ohr sondern auf Abstand vor mich hin und wandere beim Zuhören und Reden durch den Wohnraum. Dabei fällt mir auf: ich höre schlecht. Ich denke, ich bin alt. Das ist neu. Das Brennglas hat mir für vieles die Augen geöffnet und tut es noch. Die Brandblase schmerzt.