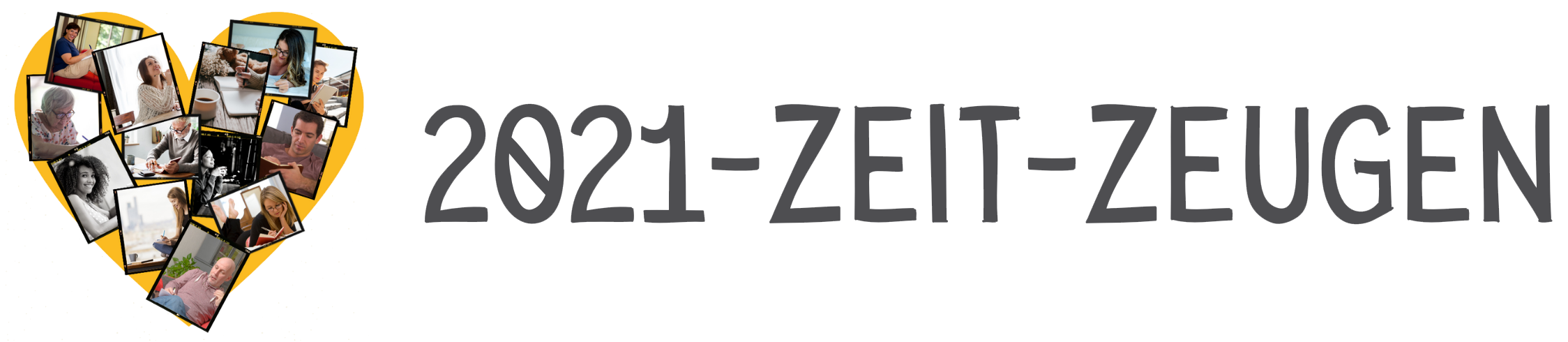Liebe Emily,
spontan ist mir, dir zu schreiben.
Du bist es, die mir als Erstes in den Kopf geschossen ist, als es hieß: Schreibe einen Brief…
Naheliegend ist es, denn zurzeit schaue ich eine Netflixproduktion über dein Leben. Fiktiv ist die Serie angelegt, versteht sich. Ob sie dir wohl gefallen würde? Ich vermute, nein, nicht wirklich…
Seit Jahren liebe ich deine Poesie. Du bist eine wahre Poetin.
Aber dass es mir ein Bedürfnis ist, gerade dir zu schreiben, rührt vermutlich noch an andere Motive: Es scheint so vielversprechend, dir meinen Brief zu widmen im Kontext von unserer sogenannten Pandemie.
Du hast auf mehreren Ebenen wie in einem harten Lockdown gelebt, – ja leben müssen.
Dir war es verwehrt, deine Gedichte in Hülle und Fülle zu veröffentlichen. Ich glaube, es waren noch nicht einmal acht zu deinen Lebzeiten, hingegen über tausende – rund 1800 Werke, um genau zu sein – erst nach deinem Tod.
Und selbst die, die zu deinen Lebzeiten der Öffentlichkeit nicht vorenthalten wurden, musstest du zuerst unter Pseudonym, unter einem Männernamen versteht sich, einreichen und preisgeben. Was für ein Wahnsinn, was für ein Frauenhass!
Es schmerzt mich heute fast körperlich, dass du nicht die Anerkennung für deine poetisch treffsichere Seele erhalten hast, die dir gebührt und die du dir sicher insgeheim gewünscht hast. Und: die dich letztlich zweifeln ließ – an deiner Gabe, deinen Botschaften, deiner Liebe zur Sprache.
Aber das hat dich nicht abgehalten, weiter und weiter und weiter zu schreiben. Deine Briefe mit Poesie anzureichern, deine Hefte in deinem Zimmer, das du in dem Sinne nie verlassen hast, mit lyrischen Kassibern, Fragmenten, fertigen und gleich mehrfachen Gedichtendfassungen zu füllen.
Es war dir ein Bedürfnis zu schreiben, vielmehr hattest du keine Wahl: du musstest schreiben. Selbst so unstillbar hungrig – nach Poesie von anderer Menschenhand, nach Bildung, nach Feinsinn und Sprache. Unentwegt schöpftest du nach Bedeutung und Metaphern, nach Rhythmus und Klang, nach Versmaß und Fülle.
Vermutlich hast du dieses Gefängnis – umrahmt von Frauenverachtung und Kleinlichkeit, von Verboten und Ungerechtigkeit, von Depression und Selbstzweifeln nur überlebt, indem du nie aufgehört hast zu schreiben. Ist es so?
Und immer wieder frage ich mich und – auf diese meine Art nun heute dich: Wie ist es dir nur gelungen, niemals nur eine Sekunde deine schreibende Seele im Stich zu lassen?
Wie hast du es ausgehalten, weltumspannende Sprachhorizonte zu überschreiten bei zeitgleicher häuslicher Enge und gesellschaftlicher Missgunst? Wie war dir bei solch einer erniedrigenden Abwertung deines eigenen Selbstverständnisses, eine wahre Poetin zu sein, diese niemals endende Wortfülle vertraut?
Was kann ich lernen von dir?
Reizte wohlmöglich die Zensur deinen Antrieb, deine innere Welt, die so viel reicher war als die da draußen, auf Papier zu bannen? Das mag auf einer Ebene logisch anmuten, psycho-logisch zu erklären sein, aber mitnichten ist es damit hinreichend erklärt.
Im Gegenteil: die Diskrepanz wurd‘ vermutlich noch schmerzhafter.
Aber, wie ist das, wenn einem die Wahlfreiheit fehlt? So, wie sie uns – es ist Jammern auf hohem Niveau, ich weiß – heute in vielfacher Hinsicht im Shutdown verwehrt ist.
Auch wir dürfen nicht reisen, nicht zehren von Konzerten und Opern, von Theater und Museen; man verwehrt uns die Kunst – sie ist für die da nicht systemrelevant!
Meine Güte, ich stelle mir vor, wie du ihnen reinen Wein einschenktest, wie du zetern und wüten würdest, und ihnen einen erzähltest vom künstlerischen Reichtum, der nichts anderes tut – als dich, als andere, als unsere Gesellschaft gesund zu erhalten, zu nähren, überhaupt zu sein.
DANKE dafür, dass es dich gab! Und du sollst wissen: Deine Gedichte nähren mich. Deine Gedichte braucht diese verrückte Welt – unbedingt. Und deine potentiellen Antworten auf meine Fragen werden mich bewegen. Da bin ich mir sicher.
Dank dir.
Der Brief gilt der wunderbaren, amerikanischen Dichterin Emily Dickinson (1830-1886)