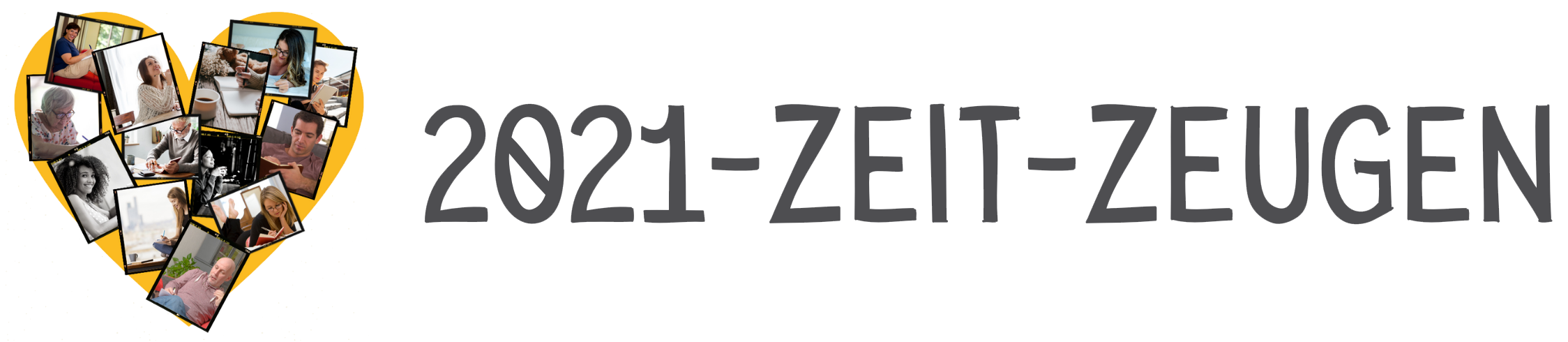Ich bin ein sehr kontaktfreudiger Mensch. Auch in neuen Gruppen fällt es mir nicht schwer, auf Menschen zuzugehen und Kontakte zu knüpfen.
In meinem Leben vor Corona war ich viel in Gruppen unterwegs. Ich singe im Chor, ich mache Zumba, ich gehe zum Qigong und zusammen mit meinem Liebsten zum Standard-Tanzen. Und ich leite selbst Gruppen zum biografischen Schreiben an – Frauengruppen.
Ich habe gerade einmal auf mein Handy geschaut und die Anzahl der Kontakte nachgesehen. Es sind 625.! Diese Zahl erschreckt mich selber, wenn ich sie jetzt so schwarz auf weiß auf dem Papier lese. „Du bist eine Menschensammlerin“, sagte einmal eine Freundin zu mir. Ich glaube, sie hat recht.
Natürlich sind nicht alle diese Kontakte private und noch weniger sind echte Freundschaften. Die Frauen, die ich als meine Freundinnen bezeichne, kann ich an zwei Händen abzählen. Vor allem sie fehlen mir in einer Zeit wie dieser.
Nie im Leben hätte ich mir vorstellen können, auf so wenige Kontakte eingeschränkt zu sein. Ich bin Hochrisiko-Patientin, über 60 Jahre alt, habe zwei onkologische Erkrankungen. Bluthochdruck, schweres Asthma… und: ich lebe in einer Stadt, mit fast 4 Millionen Einwohnern. Keine gute Mischung!
War ich im Frühling 2020 noch unbekümmert und arglos angesichts der Pandemie, so wandelte sich meine Einstellung proportional zum Anstieg der Infektionszahlen und Todesfälle. Seit November 2020 lebe ich in einem Lockdown, wie ihn sich keine Politikerin zu verordnen trauen würde. Ich treffe nur noch meinen Lebensgefährten. Wir wohnen nicht zusammen, sehen uns aber drei bis viermal in der Woche bei mir oder bei ihm. Zum Glück wohnen wir nicht weit auseinander. Der einzige andere Mensch, der meine Wohnung betritt, ist alle vierzehn Tage meine Putzhilfe. Ich öffne ihr die Wohnungstür und verschwinde dann sofort in meinem Arbeitszimmer. Wenn sie das Arbeitszimmer putzen möchte, husche ich in einen anderen Raum.
Wenn ich nicht gerade einen dringenden Arzttermin habe, nutze ich keine öffentlichen Verkehrsmittel. Da ich kein Auto besitze, ist mein Radius auf den Bereich beschränkt, den ich fußläufig erreichen kann. Besonders in den letzten beiden Wochen war das schmerzhaft. Wie gerne wäre ich an einen See oder in einen Wald gegangen und hätte das Winterwunderland bestaunt. Fotos im WhatsApp-Status von Freundinnen zeigten mir allabendlich, wie schön es im Grunewald, am Teufelsberg oder am Stadtrand aussah, wenn der Schnee die Landschaft verzaubert hatte. Meine Spaziergänge beschränkten sich auf das Häusermeer in meinem Kiez. Sehr schnell war die weiße Schneepracht zertrampelt oder in eine graubraune, manchmal rutschige Masse verwandelt.
Auch den Kontakt zu meinen Freundinnen schränkte ich mehr und mehr ein. Ab Dezember fanden „Treffen“ nur noch am Telefon statt. Ich erhoffte mir nur ein „physical distancing“ statt eines „social distancing“. Mit all meinen Freundinnen kann ich gut reden. Worte sind die Brücke zu unseren Herzen. Auch am Telefon gelang es uns, diese Nähe herzustellen. Gehört werden, ein offenes Ohr finden – das tut mir gut! Und dennoch ist es nicht dasselbe wie ein leibhaftiges“ Treffen. Diese fehlen mir sehr.
„Erst am DU wird der Mensch zum ICH“, hat Martin Buber einmal gesagt. Ich glaube, in uns allen gibt es ein tiefes Bedürfnis, gesehen und gehört zu werden, so wie wir sind -ganz ohne Masken, ja auch ohne Schutzmasken! Und das Sehen fehlt mir bei meinen Freundinnen. Mit einer mache ich jetzt regelmäßig Videoanrufe, aber auch das ist kein wirklicher Ersatz für ein echtes Treffen.
Im letzten Monat habe ich zweimal eine Ausnahme von meinen selbst auferlegten strengen Kontaktbeschränkungen gemacht. Ich hatte in meine Heimat an den Niederrhein fahren wollen. Meine Mutter ist letztes Jahr gestorben und es zog mich an ihr Grab. Und zwei Tage vor meiner Reise sagt mir meine Cousine, bei der ich sonst immer wohne, meinen Besuch wegen Bedenken ihres Mannes ab. Über den Kopf habe ich das natürlich sofort verstanden und akzeptiert. Aber mein Gefühl kam da nicht mit. Ich war total enttäuscht und tagelang aus der Spur gesprungen. Erst als ich mir schreibend darüber klar wurde, dass mein inneres Kind jetzt noch einmal heftig um den Verlust seiner Mutter und seines Elternhauses trauert und weint, konnte es in mir wieder ruhiger werden.
Als ich diese Bedürftigkeit und Dünnhäutigkeit spürte, habe ich mich zweimal mit jeweils einer Freundin getroffen. Die beiden haben mich mit ihren Autos abgeholt. Ich trug meine FFP2 Maske und wir sind ins Grüne gefahren, wo wir dann spazieren gegangen sind. Das hat mir so gut getan.
Mein Leben ist einsamer geworden. Ich muss mir künftig regelmäßig solche Freudeninseln schaffen, damit ich nicht einsam werde.