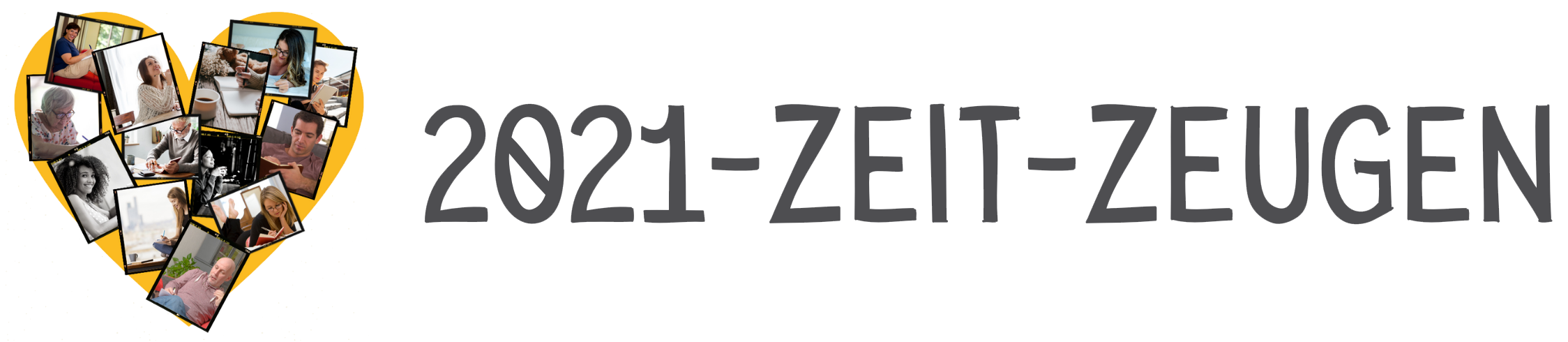„Mal nachsehen, wie das Wetter heute ist, es soll ja schon wieder trocken, hell und sonnig sein.“
Sonntag, 10 Uhr. Ich liege noch immer im Bett und um mich herum ist es dunkel. Die Rollläden halten die Umwelt noch draußen, da wo sie hingehört. Dunkel ist es in mir. Seit vor einigen Monaten mein Mann gestorben ist und der Platz in meinem Bett neben mir leer ist, wenn ich nach dem Aufwachen die Hand nach ihm ausstreckte. „Endlich aufstehen! Du kannst doch nicht den ganzen Tag im Bett liegen.“
Und weshalb nicht? Da muss ich nichts tun, nicht aktiv sein, mir nicht überlegen, wie ich diesen Sonntag überlebe. Ich könnte ja einen lieben Menschen aus meinem Freundeskreis anrufen. Es haben mir so viele angeboten mir zu helfen. Aber ich will niemanden sehen. Ich will allein sein. Und doch wieder nicht. Unmöglich. So etwas nennt man ein Paradoxon. Unauflöslicher Widerspruch. Es dauert. Ich drehe mich noch einmal um. Ziehe die Bettdecke hoch. Rolle mich noch einmal zusammen. Währenddessen führen die beiden Stimmen in mir ihren wohlbekannten Dialog weiter und tauschen ihre mir so vertrauten Argumente aus. Eigentlich will ich sie nicht hören. Sie sollen ruhig sein, mich nicht stören, mich ruhig liegen lassen.
Es dauert. Viel Zeit vergeht, bis sich die Stimme durchsetzt, die mich zum Aufstehen drängt. Ich weiß, dass sie es ist, die sich immer durchsetzt am Schluss. Aber ich habe Zeit gewonnen.
So viel Zeit, dass mein Frühstück nachher mit dem Mittagessen zusammenfällt. Also doch aufstehen, ans Fenstergehen und die Rollläden hochgezogen. Ich habe es befürchtet. Der Wetterbericht stimmt. Helles, gleißendes Licht löst das Dunkel in meinem Schlafzimmer auf.
Es kriecht in alle Winkel, sucht sich geheime Pfade. Nur in mich lasse ich es nicht dringen. Da ist es dunkel und so soll es bleiben.
Ein warmer, herrlicher Frühlingstag mit Vogelgezwitscher, aufbrechenden Knospen an Bäumen und Sträuchern, mit Blattspitzen der vielen Tulpen, die mein Mann im Herbst noch gesetzt hat und die jetzt die Erde durchstoßen.
Sie wollen an die Luft, ins Helle, endlich raus aus der Erde, aus dem Dunkel, der Enge, ins Weite. Anders als ich.
So einen Tag muss man ausnutzen, heißt es immer, raus, den Staub aus der Seele schütteln.
Es bleibt mir nichts anderes übrig, als auch die Rollläden in den anderen Zimmern hochzuziehen, das Licht überall hereinzulassen.
So unentschieden im Halbdunkel bleiben, das geht auch nicht. Das Licht bricht jetzt mit Gewalt in die ganze Wohnung ein und mit ihm kommt die Angst vor diesem herrlichen Sonntag, an dem man doch raus muss, den man ausnützen muss. Denn bald kommen auch wieder graue Tage. Aber die mag ich jetzt. Denn sie passen zu mir. Mit den hellen kann ich nichts mehr anfangen. Ich weiß, was mich draußen erwartet. Beim Spazieren gehen. Etwas anderes ist wie Corona ja nicht möglich.
Junge Paare, alte Paare, Mann und Frau, Mann und Mann, Frau und Frau. Aber immer zu zweit. Die anderen, die allein sind oder allein mit ihrem Hund, die nehme ich gar nicht wahr. Nur die Paare, die lachen, sich küssen, reden, sich an der Hand halten. Aber zu zweit. Und da spüre ich den Verlust nur noch mehr.Und das Alleinsein schmerzt noch mehr.
Mittlerweile habe ich gelernt, mich auch an den hellen Sonnentagen wieder zu erfreuen. Ich verabrede mich auch schon während der Woche mit Freunden, sodass ich zu einer festen Uhrzeit aus dem Bett muss.